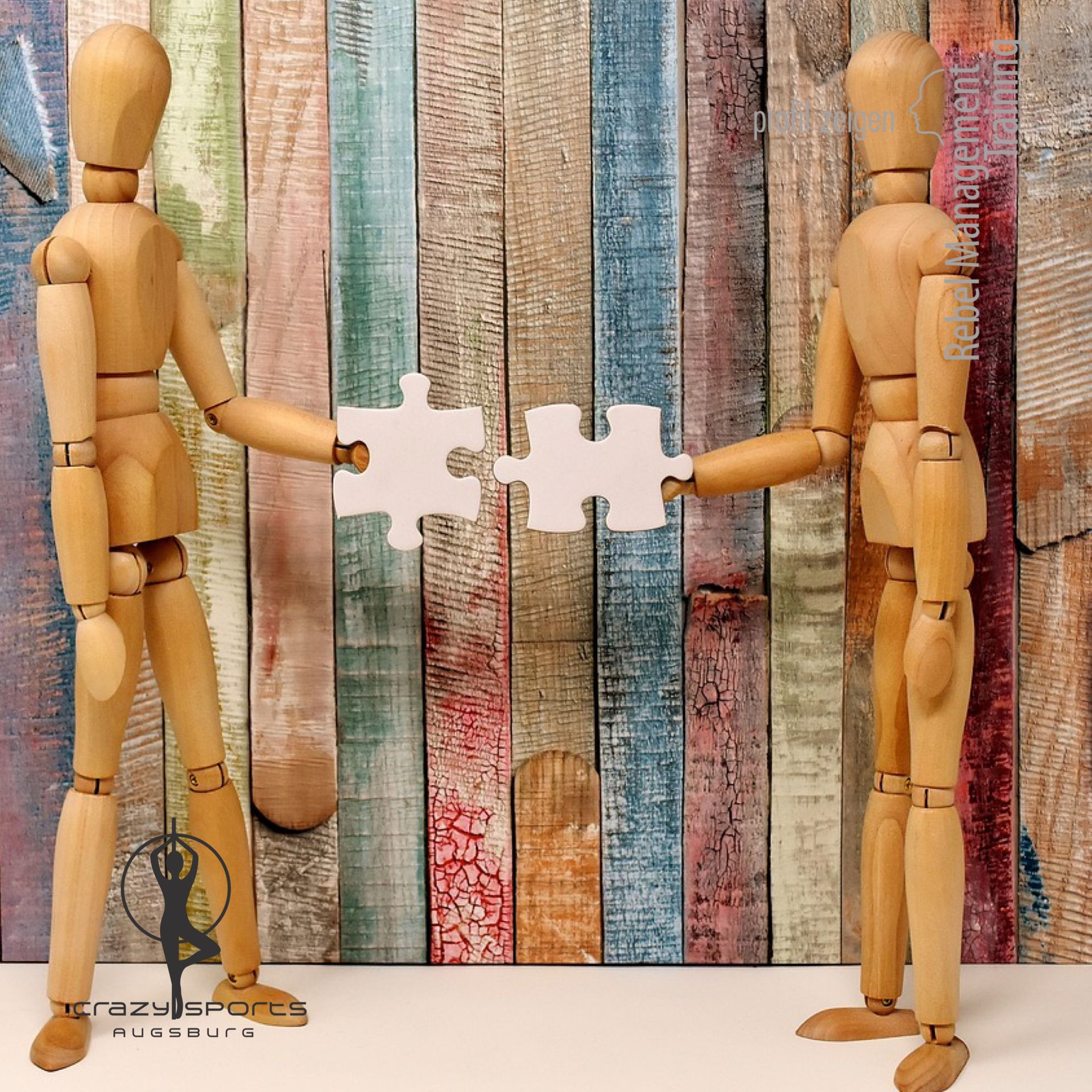Rebel-Management-Training denkt nach!
Nadine Rebel
Pathologisierung durch Wissen
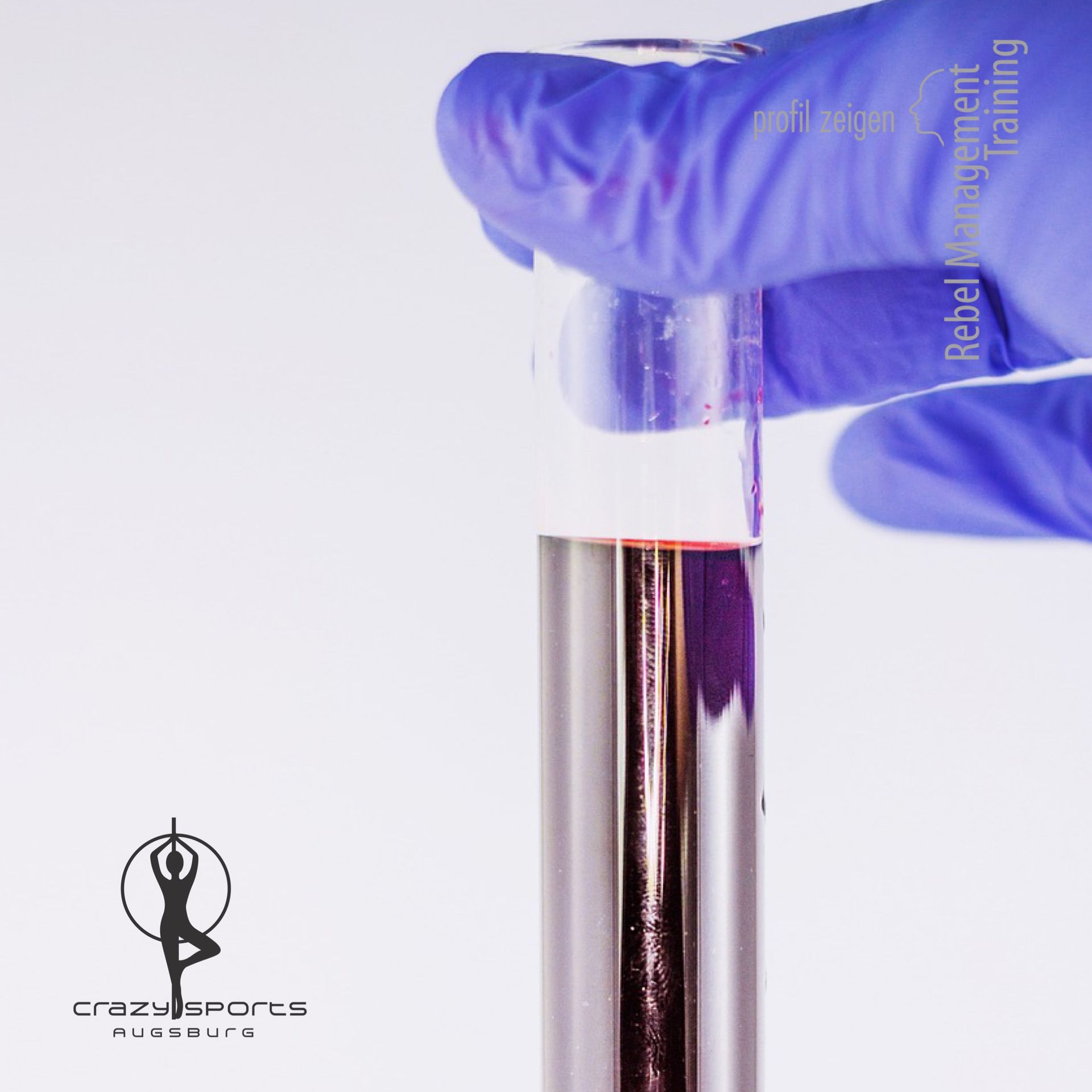
Hilft Wissen immer, mit den Situationen besser klarzukommen? Ist es sinnvoll, allen Gegebenheiten, allen Besonderheiten und allen Dingen einen Namen und ein Etikett zu verleihen? Hintergrundwissen hilft, mehr Verständnis zu entwickeln.
Aber kann es nicht unter Umständen sogar umgekehrt verlaufen? Erst das Wissen, erst die Diagnose und das Etikett, erst der Name, den man den Dingen verleiht, definiert diese als pathologisch, als krank. Und was krank ist, muss geheilt werden? Muss es das?
Namen machen Dinge real
Kopfschmerzen können von selbst vergehen, Pickel heilen von allein ab. Kein Beinbruch heilt, nur weil man ihn ignoriert. Es geht nicht darum, Ignoranz in Bezug auf Diagnostik hochzujubeln und die Errungenschaften moderner Medizin kleinzureden. Nur, weil ich die Blutvergiftung, die sich das Bein entlangfrisst, nicht benenne, wird diese nicht weniger gefährlich. Es sind Gedankenexperimente, die zu Papier gebracht werden.
Was passiert, wenn wir Dinge benennen können? Es macht sie real, es räumt ihnen einen wesentlichen Teil in unserem Leben ein. Wir geben Neugeborenen einen Namen noch bevor sie auf der Welt sind, wir nehmen Haustiere in unsere Familie auf, wenn wir ihnen einen Namen geben. Wir verbinden, bewusst und unbewusst etwas mit den Namen, die wir Dingen und Lebewesen verleihen, wir halten sie für so wichtig, dass wir sie mit einem Namen erkennungsdienstlich behandeln, unverwechselbar machen, sie erkennen und wiedererkennen wollen. Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass sie kein flüchtiger Bestandteil in unserem Leben sein werden, wenn wir ihnen einen Namen geben.
Ein Mensch ist ein Mensch und somit ein Lebewesen von vielen auf dem Planeten. Eine Katze ist eine Katze und ein Hund eben ein Hund. Sobald wir die Dinge benennen, räumen wir ihnen einen Platz im Leben ein, der so nicht mehr ausradiert werden kann.
Nur so lässt es sich erklären, wenn man beispielsweise den Vorschlag erhält, man solle ein Fundtier nicht benennen, denn dann würde es umso schwerer werden, sich wieder von diesem zu trennen.
Hinter der Benennung von Dingen und Lebewesen, von Umständen, die uns beeinflussen steckt demnach zunächst etwas sehr Schönes.
Was passiert aber, wenn wir jedem Beschwerdebild, welches uns ein Stück weit auf unserem Lebensweg begleitet und von dem wir zu Beginn nicht wissen, wie lang dieses Stück sein wird, einen Namen geben?
Allgemein oder spezifisch
Ohne Namen und ohne Bezeichnung sind Dinge und auch Beschwerdebilder unspezifisch. Es gibt Hautprobleme, Rückenschmerzen, Erkältungen, sonderbare und komische Menschen.
Ohne nähere Bezeichnung, ohne Namen und Diagnose klingt das recht unspektakulär.
Wenn aber aus der trockenen Haut eine Neurodermitis, aus den Rückenschmerzen eine ISG-Blockade oder gar ein Bandscheibenvorfall wird, wenn jede Erkältung eine Bronchitis, Angina oder hochmodern Corona ist, wenn besonders lebhafte Menschen ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, wenn tiefgründige Menschen depressiv sind, wenn die Unfähigkeit, sich ab und an mit Menschen auseinandersetzen zu wollen als Autismus deklariert wird und wenn alles, was in der Kindheit nicht gut verlief zu tiefen Traumata führt, dann passiert mehr.
Aus etwas Allgemeinen wird etwas Spezielles. Aus etwas Normalen wird etwas Besonderes.
Aus etwas Vergänglichem wird vielleicht etwas Bleibendes, selbst wenn wir das so nicht beabsichtigt hatten.
Neurodermitis hat man sein Leben lang, sie schläft vielleicht und ruht über mehrere Jahre, aber der Name macht sie bleibend. Ein Bandscheibenvorfall kann heilen, danach ist man, wenn alles gut läuft, beschwerdefrei, merkt also gar nichts mehr davon.
Ohne Namen hätte man gesagt, die Rückenschmerzen seien wieder vorbei. Mit Diagnose wartet man darauf, dass sich die Sollbruchstelle wieder bemerkbar macht.
Die Vielfalt der Menschen ob nun ex- oder introvertiert, egozentrisch oder empathisch macht das Leben bunt. Jeder Mensch spinnt ein wenig und es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft damit zurechtzukommen, eben gerade, weil wir auch zu dieser Spezies gehören. Weil wir auch Menschen sind, weil auch wir spinnen.
Und weil wir alle ein wenig „gaga“ sind, liegt es auch in unserer Verantwortung, die kleinen Abnormitäten in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen zu halten.
Namen und Diagnosen nehmen uns zum Teil diese Verantwortung. Ein depressiver Mensch muss nicht mehr fröhlich sein wollen, er braucht Hilfe. Ein Mensch, der eine Beziehung nach der anderen hat, lässt nicht nur „nichts anbrennen“, er hat eine Bindungsschwäche. Ein Mensch, der alles auf einmal aufnehmen möchte und sich nicht wirklich konzentrieren kann, muss mit Medikamenten auf Spur gebracht werden.
Diagnosen nehmen Freiheit
Laut Diagnose kann die Hummel nicht fliegen. Ihre Flügel sind für ihr Volumen und ihr Gewicht nicht ausreichend, als dass sie dies ermöglichen könnten. Wie gut, dass die Hummel bei der Diagnosestellung bisher nie anwesend war.
Diagnosen helfen in vielen Fällen. Wenn man weiß, woran es liegt, dass es einem so geht, wie es einem geht, kann man eventuell sinnvoll darauf einwirken, vielleicht sogar gegensteuern.
Doch manchmal nehmen Diagnosen auch nur Freiheiten, aber auch Hoffnungen.
Diagnosen können das Todesurteil für die Hoffnung darstellen, die bekanntlich zuletzt stirbt.
Diagnosen nehmen Eigenverantwortung
Diagnosen werden manchmal wie Karma hingenommen. Ich habe nicht darum gebeten, jetzt weiß ich per Diagnose, dass es ganz schlimm ist, jetzt kann ich nichts mehr dagegen tun, nur aushalten und mit der Diagnose hausieren gehen.
Den Namen der Beschwerde nennen ist wie eine Entschuldigung und eine Eintrittskarte zugleich. Zu einem melancholischen Menschen mit belegter Depression sagt niemand, er solle doch mal wieder Freude am Leben haben oder sich ein wenig zusammenreißen.
Mein Arzt sagt mir das, meine Frauenärztin rät mir dazu, mein Endokrinologe meint.
Und man selbst? Wie „man selbst“? Die Diagnose kommt von Personen, die es wissen müssen, ich bin doch nur Träger meines Körpers voller Beschwerden.
Und so, wie die Diagnose von außen kommt, soll auch die Heilung von außen kommen.
Vor einigen Tagen hatte ich ein sehr gutes Gespräch. Meine Gesprächspartnerin macht gerade auch so Einiges durch, was mir sehr bekannt vorkommt.
Sie fragte mich, wann es denn besser werden würde (uns trennen ein paar Jahrzehnte). Als ich ihr antwortete: „Gar nicht, du lernst nur, damit besser umzugehen!“, war ich überrascht ob meiner verbalen Grausamkeit.
Sie wollte Hoffnung, Absolution, Erfahrungsdiagnostik. Ich habe ihr nur Ehrlichkeit gegeben.
Eigenempfindung braucht eine Fremdbestätigung
Umgekehrt kann allerdings auch ein Schuh daraus werden. Man weiß, wie und wer man ist, man lernt seine Besonderheiten kennen und man findet einen Namen für diese Besonderheit.
Opfer einer narzisstischen Beziehung, Hypersensibilität, oder die Verbrennungsblasen an der Hand, nachdem man bei Sonnenschein den Riesenbärenklau geschnitten hat.
Man erkennt sich und seine Beschwerden wieder (psychisch oder physisch).
Dennoch ist man noch nicht vollkommen beruhigt. Schließlich ist es nur die eigene Person, das eigene Denken über den eigenen Körper und den eigenen Kopf, welches einen zu diesen Schlussfolgerungen führt. Und man ist in diesen Dingen unwissend und inkompetent. Da muss man schon jemand fragen, der sich wirklich damit auskennt. Den Psychologen, den Psychiater, die Frauenärztin, den Urologen, den Hautarzt, den Hausarzt, den Neurologen, in jedem Fall aber mindestens den Apotheker (oder -in).
Wer kann mir das diagnostizieren, was ich bereits weiß. Prinzipiell ist es alles andere als verwerflich, sich eine zweite, unter Umständen kompetentere Meinung einzuholen, doch die Frage, die man ebenso stellen darf, ist: „Was ändert sich, wenn mir eine andere Person das bestätigt?“ Was passiert, wenn ich für mich eine Erklärung gefunden habe, und die kompetentere Person nimmt sie mir weg? Hilft mir das auf dem Weg der Heilung, in meinem persönlichen Leben, oder werden mir dadurch die letzten Strohhalme entrissen, an die ich mich noch klammere? Vielleicht steckt dahinter sogar ein wohlgemeinter Gedanke: Du musst schwimmen lernen, klammere dich nicht an Strohhalme, die helfen dir nicht.
Wenn der Mensch, der mir den Strohhalm wegnimmt, mich so lange über Wasser hält, bis ich wirklich schwimmen kann, ist die Option nicht die Schlechteste.
Oftmals entreißt mir der Diagnostiker aber nur den Strohhalm und lässt mich im Wasser allein.
Immerhin kann er weder etwas für den Sturm noch für meine Schwimmunfähigkeit.
Vorauseilende Sorgen
Als ich mit meiner Tochter schwanger war, ließ ich alle vorgeschriebenen Tests machen. Ein Vertretungsarzt offerierte mir bei einem Vorsorgetermin in lapidarem Tonfall, dass man mir bestimmt mitgeteilt hätte, dass mein Kind an einer Spina bifida (offene Wirbelsäule) leiden würde und wahrscheinlich nicht (lang) lebensfähig wäre.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es mir den Boden unter den Füßen wegzog, wie tausend Gedanken auf einmal kreisten, wie ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen und dennoch innerlich sicher war, dass ich für dieses Kind da sein wollen würde.
Wie durch einen Nebel vernahm ich die Stimme des Arztes, wahrscheinlich keine 5 oder 10 Sekunden später, der mir mitteilte, er hätte sich verlesen, es wäre alles in bester Ordnung.
Meine Sorgen waren vorauseilend und dauerten nur wenige Sekunden, aber diese waren sehr tragisch und taten sehr weh. Diese Sekunden werde ich nie vergessen.
Wie aber ist es, wenn man mit Anfang 20 gesagt bekommt, dass man wahrscheinlich keine Kinder bekommen können wird, dass die Wahrscheinlichkeit, später an Brustkrebs zu erkranken hoch ist, weil man hier eine familiäre Prädisposition hätte, wenn eine außenstehende (kompetente) Person mir sagt, was unter Umständen Jahrzehnte später eintreten kann?
Welcher Mensch kann von sich behaupten, er würde dies dann alles einfach vom Tisch wischen in der Überzeugung, dass die Zeit zeigen wird, was sie zeigen will und dass heute heute ist und morgen ein neuer Tag und man von Übermorgen gar nicht reden muss?
Diagnosen können stigmatisieren. Das kannst Du nicht, denke daran, Du bist als Hummel zur Welt gekommen. Bitte begrabe den Traum, fliegen zu können.
Wenn Du das jetzt tust, dann wird es nur schlimmer. Lass‘ dir das gesagt sein, immerhin haben es kompetente Personen, ja vielleicht sogar „die“ Wissenschaft herausgefunden.
Die Stigmatisierung läuft in einem selbst ab und bestimmt auch den Platz, den man in der Gesellschaft bekommt. Lass‘ die Hummel mal. Die brauchen wir nicht fragen, ob sie zum Ausflug mitkommt, die kann doch nicht fliegen.
Entartete Individuation
Mitunter beschleicht mich die Vermutung, diagnostizierte Krankheiten gehören heute zur gewünschten Individuation dazu. Man möchte dazugehören und dennoch etwas Besonderes sein. Rückenschmerzen hat jeder, aber eine Skoliose, eine ISG-Blockade oder Bandscheibenvorfälle können nicht alle vorweisen.
Beschwerdebilder können auch Gesprächsstoff liefern und mit kranken Menschen geht man nicht so offen um, wie man es mit scheinbar Gesunden tun würde. Man nimmt Rücksicht, man hält sich zurück, man stellt die eigenen Empfindungen hinten an. Schließlich ist man gesund und der andere krank.
Da wir alle krank sind, können und sollten wir uns alle gleichermaßen gut oder danebenbenehmen.
Verständnis ist keine Entschuldigung
Und doch sind Diagnosen wertvoll. Dann, wenn sie zum Verständnis beitragen. Dann, wenn man sich durch einen Namen, durch die Benennung eines Beschwerdebilds (physisch oder psychisch) besser in das Gegenüber versetzen kann. Dann, wenn man weiß, dass kein ungehobeltes Verhalten ist, wenn jemand plötzlich aufgrund einer Reizüberflutung das Zimmer verlässt oder etwas schroff reagiert.
Wenn die Diagnose des Besonderen zur Normalität beiträgt, weil man versteht, dass der Mensch nicht durchdreht, sondern sich nur aufgrund von XY komisch verhält, dann können Namen, Etiketten und Diagnosen hilfreich sein.
Man sollte nur nicht von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen.
Die mangelnde Fähigkeit mit Lärm oder Reizen umzugehen, stellt keinen Freifahrtschein dar, sich überall sozial inkompatibel zu verhalten, um es dann auf die „Reizüberflutung“ zu schieben.
Die schwere Kindheit ist auch irgendwann vorbei und die Traumata, die man erlebt hat, erlauben dennoch nicht, erfahrenes Leid anderen anzutun.
Die Genese, die Geschichte und die Besonderheiten eines Menschen zu verstehen und bis zu einem Gewisse Grad mittragen zu können ist nicht gleichbedeutend damit, dass man jedes Verhalten entschuldigt, weil man eine Diagnose, einen Namen oder eine Störung hat.
Gesunde Mischung
Die gesunde Mischung macht es aus. Bringt es mich weiter, wenn ich es weiß? Kann ich es heilen, wenn ich es weiß? Oder ändert sich nichts? Muss ich mich testen, wenn ich Husten, Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen habe? Macht es einen Unterschied, ob ich wegen eines grippalen Infekts oder wegen Corona im Bett bleibe?
Will ich mir ein Schild umhängen: „Habe schon 2, 3, 4 Bandscheibenvorfälle. Werde immer wieder Rückenschmerzen haben“, oder trainiere man einfach weiter, weil Muskulatur in jedem Fall hilft, ganz gleich, ob der Rücken noch gesund oder schon kaputt ist.
Hat das Wissen das Potential mir zu mehr Stärke, Glück und Zufriedenheit zu verhelfen oder wird es meinen inneren Frieden kosten.
Je nachdem, wie man für sich entscheidet, kann eine Diagnose helfen oder die Sachlage verschlimmern.
Rebel-Management-Training BLOG